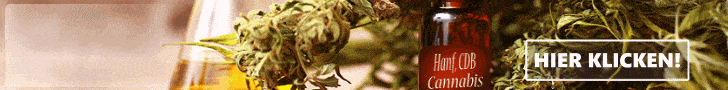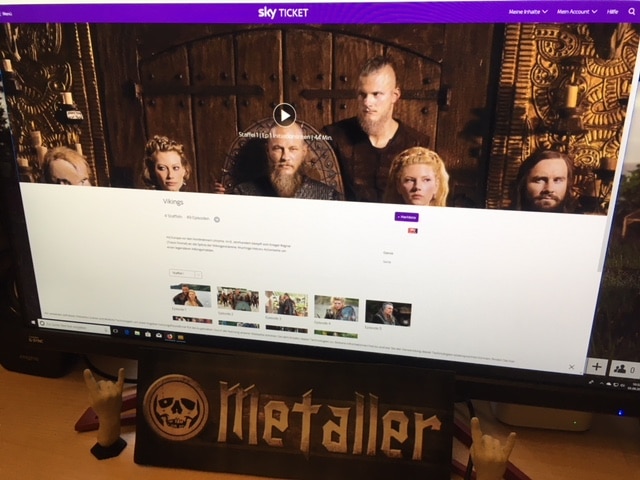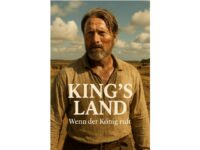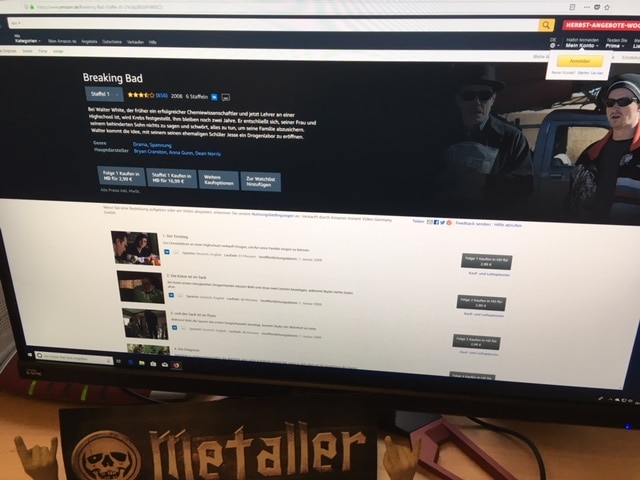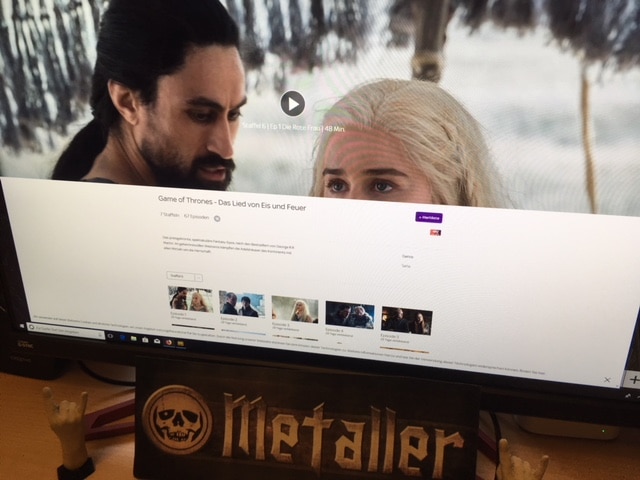Willkommen in Teheran, wo politische Karriere mit einem kleinen Nebeneffekt daherkommt: einem Familienleben auf Standgas.
Ein Richter, ein Revolutionsgericht und die ganz große Verwirrung

In Die Saat des Heiligen Feigenbaums, dem neuen Werk von Regisseur Mohammad Rasoulof (bekannt für subtiles Drama mit der Emotionalität eines Vorschlaghammers), wird der bräsige Durchschnittsbürger Iman zum Untersuchungsrichter am Revolutionsgericht befördert. Yay! Oder auch nicht.
Denn kaum hat Iman sein Büro im repressiven Regierungskomplex bezogen, bricht draußen die Hölle los. Der Auslöser: Der Tod einer Frau, der Proteste wie eine schlecht gesicherte Gaspipeline explodieren lässt. Was tut man als frischgebackener Richter? Klar, man stellt sich auf die Seite des Regimes – was soll schon schiefgehen?
Spoiler: eine Menge. Und zwar vor allem im eigenen Wohnzimmer.
Die Familie – zwischen Fassungslosigkeit und Wutanfällen
Imans Familie reagiert auf seine neue Rolle ungefähr so begeistert wie ein Vegetarier auf ein Grillfest mit ausschließlich Fleischplatten. Seine Töchter können kaum glauben, dass ihr Vater jetzt als Erfüllungsgehilfe eines Systems fungiert, gegen das sie protestieren würden – wenn sie dürften.
Während die Mädels also schockiert in ihre veganen Kekse beißen und von Fluchtplänen nach Schweden träumen, gibt sich Imans Frau die größte Mühe, den Laden zusammenzuhalten. Sie ist die typische persische Mutter, die im Angesicht von emotionalen Hurrikans versucht, mit Tee und mildem Lächeln den Weltuntergang abzuwenden.
Plot Twist mit Knall: Die verschwundene Knarre
Gerade als man denkt, es könnte nicht schlimmer werden, verschwindet auch noch Imans Dienstwaffe. Nicht etwa bei einem Drogeneinsatz oder im dichten Stadtverkehr – nein, ausgerechnet zu Hause, zwischen Bügelwäsche und Geschirrspüler. Und wie jeder gute paranoide Ehemann mit Hang zu politischen Intrigen, verdächtigt Iman direkt seine Familie.
Die Reaktion? Zwischen „Ernsthaft jetzt?“ und „Ich zieh aus, Baba!“ pendeln sich die Emotionen ein. Die Lage im Wohnzimmer entwickelt sich zu einer Mischung aus Sherlock Holmes, Reality-TV und einem Kabinett der zwischenmenschlichen Abgründe.
Ein Film zwischen Drama, Wahnsinn und iranischer Realität
Regisseur Mohammad Rasoulof, der übrigens selbst schon ordentlich Ärger mit den Behörden hatte (Ironie-Alarm!), liefert hier keine leichte Kost. Mit einer Laufzeit von sportlichen 2 Stunden und 47 Minuten (ja, das ist fast ein Marvel-Film in Kunstkino), bekommt man eine intensive Mischung aus Gesellschaftskritik, Familiendrama und politischen Nebelkerzen.
Ein Blick in die Abgründe einer Diktatur
Rasoulof zeigt uns nicht nur einen Mann im inneren Konflikt, sondern auch das Porträt eines Systems, das seine Leute frisst – und sich dabei noch für moralisch überlegen hält. Während draußen protestiert wird, zerbricht drinnen eine Familie. Und genau das macht den Film so erschreckend echt.
Waffen, Wahrheit und Wahnsinn
Die Waffe, die verschwindet, ist mehr als nur ein Requisit – sie steht symbolisch für Macht, Vertrauen und die Fragilität familiärer Bindungen in einem repressiven System. Und wenn der eigene Vater plötzlich seine Töchter verdächtigt, Teil einer Verschwörung zu sein, dann weißt du: Diese Familie geht nicht mehr gemeinsam zum Brunch.
Oscar®-Nominierung? Zurecht!
Ja, dieser Film wurde tatsächlich für den Oscar® nominiert – und das zu Recht. Rasoulof versteht es wie kaum ein anderer, mit minimalistischer Kameraarbeit und messerscharfen Dialogen eine bedrückende Atmosphäre zu erzeugen. Der Film kriecht einem unter die Haut wie ein schlechter Ohrwurm – nur eben auf politisch hochbrisantem Niveau.
Die Darsteller – Zwischen Nervenzusammenbruch und Weltklasse
Missagh Zareh als Iman liefert eine Performance ab, die irgendwo zwischen tragisch, verpeilt und tief erschütternd pendelt. Seine Frau, gespielt von Soheila Golestani, ist die stille Heldin des Films – diplomatisch, ruhig und die personifizierte Schmerzgrenze.
Die Töchter (Mahsa Rostami, Setareh Maleki, Niousha Akhshi) bilden das Herz der Geschichte. Ihre Reaktionen, Wutanfälle und inneren Kämpfe sind nachvollziehbar und liefern dem Zuschauer Momente zum Durchatmen – oder auch zum Mitweinen.
*** Anzeige ***
Kaufe .de Cannabis-, Hanf- und CBD-Domains und investiere in eine grüne Zukunft!
Sichere dir jetzt deine Cannabis Wunschdomain bevor es jemand anderes tut!
Hier günstig Cannabis-Domains kaufen!Verkauf solange verfügbar – Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten.
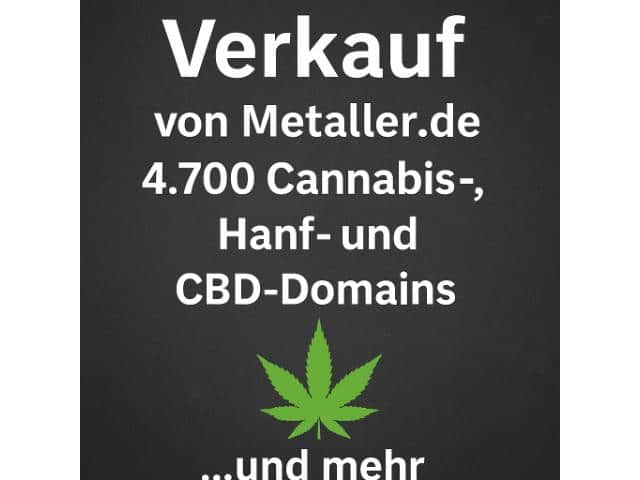
Werbung
Eine Familiengeschichte, die sich wie ein Politthriller liest
Was Die Saat des Heiligen Feigenbaums so besonders macht, ist die Kombination aus intimer Familiendynamik und großer politischer Tragweite. Während der Zuschauer durch die Linse des Hauses blickt, fühlt es sich an, als würde man gleichzeitig ein ganzes Land verstehen lernen.
Es ist die Geschichte von Iman, ja. Aber es ist auch die Geschichte unzähliger Menschen, die sich in einem System zurechtfinden müssen, das sie zu kleinen Zahnrädern in einer gigantischen Unterdrückungsmaschine macht.
Lang, aber lohnenswert – oder: Warum man Popcorn braucht
Zugegeben, mit 2 Stunden und 47 Minuten ist dieser Film kein Snack für zwischendurch. Man sollte gut ausgeschlafen sein, die Blase vorher entleeren und ein paar Snacks bereithalten – denn Aufstehen während der Vorstellung wäre eine Sünde.
Aber wer durchhält, wird belohnt. Mit intensiven Momenten, gesellschaftlichem Tiefgang und einem Soundtrack, der das Drama zusätzlich unterstreicht, als wäre er von einer melancholischen Geige geschrieben worden.
Fazit: Tiefgründig, beklemmend, brillant
Die Saat des Heiligen Feigenbaums ist kein Film für zwischendurch, kein Film zum Lachen oder zum Abschalten – es ist ein Werk, das dich zwingt, hinzusehen. Ein politischer Spiegel, ein Familiendrama und ein psychologisches Kammerspiel in einem. Und auch wenn man am Ende mit einem Kloß im Hals dasitzt, bleibt der Eindruck: Wow. Das war großes Kino.
Und ein kleiner Tipp zum Schluss: Wenn du glaubst, dein Familienleben ist kompliziert – schau diesen Film. Danach erscheint dir jedes Weihnachtsessen wie ein Wellnessurlaub.
———-
Autor und Bild: Film-Zeitler
Kein Anspruch / Gewähr auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit