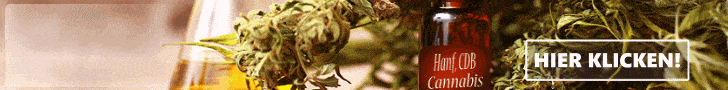Seit der Legalisierung von medizinischem Cannabis im Jahr 2017 hat sich die Behandlung mit Cannabinoiden in Deutschland zunehmend etabliert. Doch wer kann medizinisches Cannabis verschrieben bekommen und wie läuft der Prozess der Verordnung ab? In diesem Artikel beleuchten wir die rechtlichen Grundlagen, die medizinischen Indikationen sowie den Weg von der ärztlichen Diagnose bis zur Apotheke.
Voraussetzungen für eine Therapie mit medizinischen Cannabisblüten

Nicht jeder Patient kann Cannabis auf Rezept erhalten. Laut den gesetzlichen Vorgaben ist eine Verordnung nur dann möglich, wenn:
• eine schwerwiegende Erkrankung vorliegt,
• andere Therapieoptionen ausgeschöpft oder nicht geeignet sind,
• und der behandelnde Arzt eine positive Wirkung von Cannabis auf die Symptomatik erwartet.
Häufige Anwendungsgebiete sind chronische Schmerzen, Spastiken bei Multipler Sklerose, Übelkeit und Erbrechen während einer Chemotherapie sowie bestimmte neurologische und psychiatrische Erkrankungen wie Tourette oder ADHS.
Auch bei entzündlichen Erkrankungen wie Morbus Crohn oder rheumatoider Arthritis kann der Einsatz von medizinischen Cannabisblüten in Erwägung gezogen werden. Die Entscheidung über eine Therapie mit Cannabis trifft der behandelnde Arzt nach eingehender Prüfung der individuellen Patientensituation.
Schritt für Schritt zur Cannabis-Verordnung: Der Prozess der Verschreibung
Der Weg zur Verordnung von medizinischem Cannabis ist mehrstufig und beginnt mit einem ärztlichen Beratungsgespräch. Hier erklärt der Mediziner die möglichen Vor- und Nachteile der Therapie und prüft, ob die gesetzlichen Kriterien erfüllt sind.
1. Krankheitsbild und ärztliche Beurteilung: Der behandelnde Arzt stellt fest, ob die Erkrankung die Voraussetzungen für eine Cannabistherapie erfüllt.
2. Vereinfachte Genehmigung für bestimmte Ärzte: Die Verpflichtung, vor einer Erstverordnung eine Genehmigung der Krankenkasse einzuholen, entfällt mittlerweile für bestimmte Arztgruppen, sodass der Zugang für Patienten in einigen Fällen erleichtert wird.
3. Begleitung der Behandlung: Da die Therapie mit medizinischem Cannabis streng reguliert ist, müssen Patienten regelmäßige Kontrolluntersuchungen wahrnehmen, um die Wirksamkeit und mögliche Nebenwirkungen zu bewerten.
4. Rezeptausstellung und Bezug in der Apotheke: Nach der Verordnung durch den Arzt erhalten Patienten ihr medizinisches Cannabis in einer spezialisierten Apotheke, ohne dass ein Betäubungsmittelrezept erforderlich ist.
Medizinische Cannabisprodukte: Unterschiedliche Darreichungsformen verfügbar
Medizinisches Cannabis steht in verschiedenen Darreichungsformen zur Verfügung, die individuell an die Bedürfnisse des Patienten angepasst werden können. Eine der häufigsten Varianten sind Cannabisblüten, die entweder inhaliert oder als Tee konsumiert werden. Sie enthalten eine natürliche Kombination aus Cannabinoiden und Terpenen, die für die therapeutische Wirkung maßgeblich sind.
Daneben gibt es Cannabisextrakte, die in standardisierter Form angeboten werden und eine genauere Dosierung ermöglichen. Diese Extrakte können oral eingenommen oder verdampft werden, was eine bessere Kontrolle über die verabreichte Wirkstoffmenge ermöglicht. Für Patienten, die eine besonders präzise Dosierung benötigen, stehen zudem Fertigarzneimittel zur Verfügung. Diese Präparate enthalten definierte Mengen an THC und CBD und sind für spezifische Indikationen zugelassen.
Die Wahl der richtigen Therapieform erfolgt stets in Absprache mit dem behandelnden Arzt. Eine besondere Rolle spielt dabei die Dosierung, da jeder Körper individuell auf die Wirkstoffe THC und CBD reagiert. In vielen Fällen ist eine sogenannte Einschleichphase erforderlich, in der die optimale Dosis schrittweise ermittelt wird.
Aktuelle Hürden und zukünftige Entwicklung bei der Verschreibung
Trotz der positiven Entwicklungen gibt es nach wie vor Hürden bei der Cannabistherapie in Deutschland:
• Genehmigungsquote der Krankenkassen: Obwohl viele Anträge bewilligt werden, kommt es in einigen Fällen zu Ablehnungen. Patienten können in solchen Fällen Widerspruch einlegen oder sich an eine spezialisierte Beratungsstelle wenden.
• Verfügbarkeit und Preise: Aufgrund der Importabhängigkeit schwankt das Angebot an Cannabisblüten, und die Preise sind oft hoch. Viele Apotheken haben zudem nur begrenzte Vorräte, was zu Engpässen führen kann.
• Forschungslage: Während erste Studien vielversprechend sind, wird weiterhin intensive Forschung betrieben, um die Wirksamkeit in verschiedenen Indikationen besser zu belegen. Klinische Studien laufen derzeit unter anderem zu Anwendungen bei Depressionen, posttraumatischer Belastungsstörung (PTBS) und Migräne.
• Rechtliche Unsicherheiten: Während medizinisches Cannabis unter bestimmten Voraussetzungen legal ist, gibt es weiterhin Unsicherheiten im Straßenverkehr. Patienten müssen sich über die geltenden Grenzwerte und rechtlichen Vorgaben informieren, um Probleme mit der Fahrerlaubnis zu vermeiden.
Weitere Informationen zur rechtlichen Situation bietet die Bundesopiumstelle. Wer sich für allgemeine Aspekte zur Cannabisverordnung interessiert, findet zudem hilfreiche Inhalte bei der Kassenärztlichen Bundesvereinigung. Zudem gibt es spezialisierte Patientenverbände, die Betroffene bei Anträgen und rechtlichen Fragen unterstützen.
Fazit: Zugang bleibt eine Herausforderung
Medizinisches Cannabis hat sich als wichtige Therapieoption für viele Patienten etabliert, ist jedoch weiterhin mit bürokratischen Hürden verbunden. Die Vielzahl an Anwendungsbereichen zeigt das Potenzial der Cannabinoid-Therapie, doch die rechtlichen und regulatorischen Vorgaben erschweren oft den Zugang. Wer Anspruch auf eine Verordnung hat, sollte sich ausführlich informieren und gemeinsam mit dem behandelnden Arzt den besten Weg zur individuellen Therapie finden. Eine fortlaufende Anpassung der Gesetzgebung und eine intensivere Forschung könnten in Zukunft zu einer noch breiteren Akzeptanz und besseren Versorgung beitragen.
———-
Autor und Bild: Canna-Chad Gregor Paul Thiele
Kein Anspruch / Gewähr auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der News bzw. Pressemeldung
Beachte hierzu auch den medizinischen Haftungsausschluss!